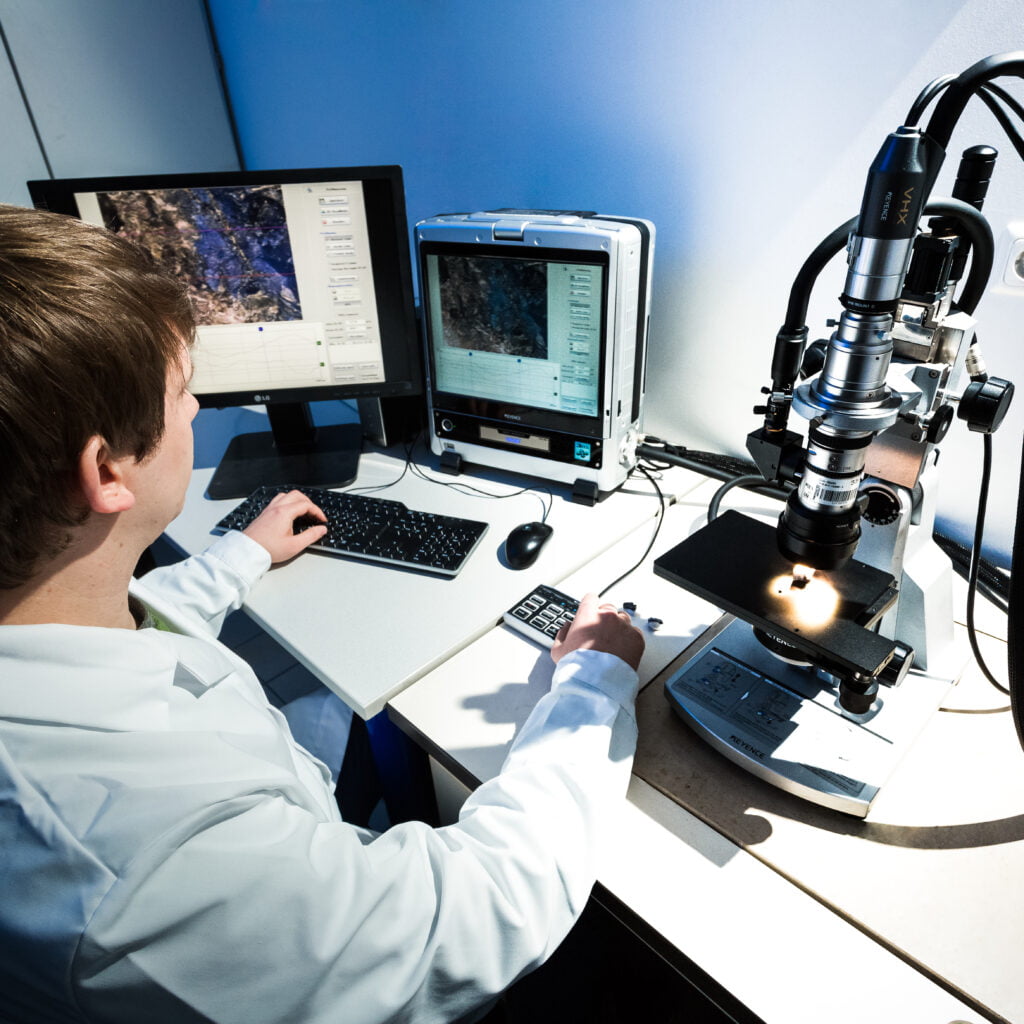Research » Aluminum Recycling and Melt Purification
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Ungefähr 21% der globalen Treibhausgasemissionen (GHG) werden vom Industriesektor verursacht. Die zunehmende Besorgnis über den globalen Klimawandel veranlasst viele Industrien, Projekte zur Senkung des "CO2-Fußabdrucks" zu verfolgen, um ihre Auswirkungen auf das sich ändernde Klima zu reduzieren. Null CO2-Emission in der Primärherstellung ist daher das Ziel für die weltweite Aluminiumindustrie. Die Aluminiumindustrie arbeitet seit Jahrzehnten an der Entwicklung eines CO2-freien Herstellverfahrens, indem sie die horizontalen Kohlenstoffanoden in den bei 960°C arbeitenden Elektrolysezellen von Hall-Héroult durch inerte Nicht-Kohlenstoffanoden ersetzt, ohne jedoch einen technischen oder kommerziellen Erfolg zu erzielen, was hauptsächlich auf Materialprobleme bei dieser hohen Betriebstemperatur, Verunreinigungen des erzeugten Metalls sowie auf einen erhöhten Energieverbrauch zurückzuführen ist.
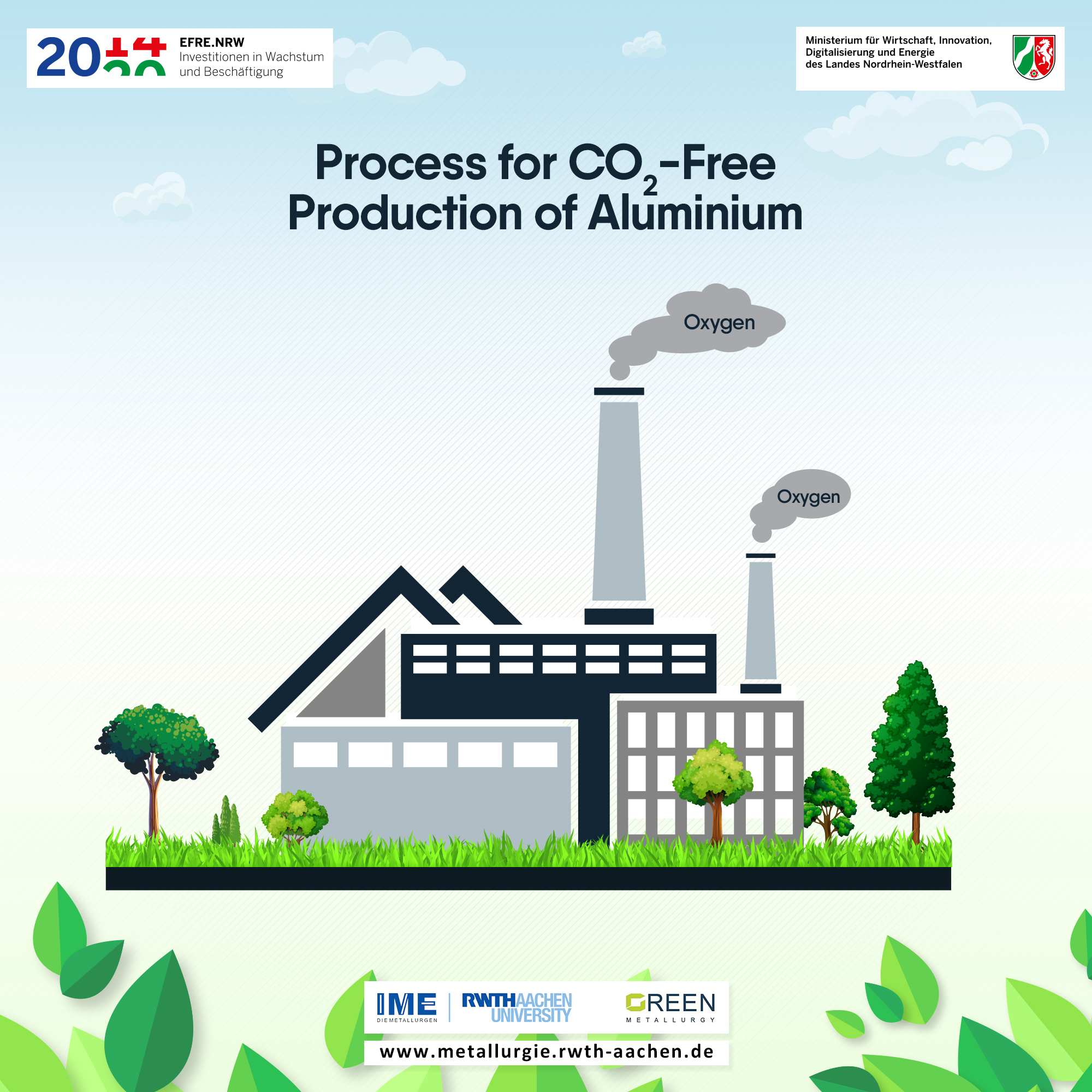
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Das Projektziel ist die Verfahrensoptimierung der thermischen Vorbehandlung und des Schmelzens organik-kontaminierter Aluminiumschrotte mit gesteigertem Aluminium-Ausbringen und reduziertem Primärenergiebedarf. Dies soll durch die effiziente energetische Nutzung der Thermolysegase möglich werden, was bisher in industriellen Prozessen nicht erreicht wurde. Die Prozessoptimierung wird durch die grundlegende Bewertung eines Mikrowellendrehrohrofens zur Thermolyse von Aluminiumschrotten, der Entwicklung eines Regelsystems zur Schwachgasverbrennung aus der Thermolyse und dem technischen Vergleich von drei industriellen Schmelzprozessen begründet. Mit der Verfahrensentwicklung und den daraus gewonnenen charakteristischen Kenndaten ist man am Ende des Projekts in der Lage diese Technologie zu nutzen. Den Anlagenbauern und -betreibern stehen dann die Kenndaten zur Verfügung, um neue Pilot-/Produktionsanlagen auszulegen und marktgerecht zu positionieren.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Da weltweit kein Forschungszentrum oder Unternehmen diese Zielrichtung verfolgt oder ein ähnliches Verfahren entwickelt bzw. betreibt, ist das Innovationspotenzial dieser Verfahrensidee offensichtlich. Die Innovation, aber zugleich auch Herausforderung hierbei ist, die notwendigen chemisch-physikalischen Eigenschaften der Salzmischungen aufrechtzuerhalten und sogar zu verbessern, wenn der KCl-Gehalt der Salzmischung abgesenkt wird. Führt dieser Weg zum Erfolg, so ist eine Senkung der Produktionskosten sofort messbar.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Research Area
Description
-
In Metallgewinnungs- und Recyclingverfahren wie für Magnesium, Aluminium, sogar Kupfer oder Zink werden Salzschmelzen eingesetzt, die meist KCl, NaCl und CaF2 enthalten. Sie haben die Aufgabe, Oberflächenoxide, Gase oder andere Verunreinigungen von Metall zu trennen und die Metallphase von der Atmosphäre zu isolieren. Es ist Stand der Technik, dass die Anwendung von Salzfluss in Kontakt mit kontaminierten Rohmaterialien wie Schrott unweigerlich zur Bildung einer Salzoxid-Metall-Suspension führt, die sowohl die metallischen als auch die oxidierten Metall- und Salzbestandteile enthält. Bisher war es noch nicht möglich, diese Schlammbildung in Bezug auf Metallverluste und Prozessdurchführbarkeit zu kontrollieren.

Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Das Projektziel dieses Antrags ist die detaillierte Stoffbilanz und Erfassung sowie Bewertung der Schmelzmetallurgie für Formgießereien im Tiegel-Induktionsofen und in Formatgießereien im Induktionsofen und Mehrkammerofen mit Vortex und EMP bei der Wiederverwertung von innerbetrieblichen Al-Bearbeitungsspänen. Zudem wird eine Abgrenzung zu anderen Schmelzaggregaten, in denen Al-Kreislauf wiederverwertet wird, vorgenommen.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Das vornehmliche Ziel ist die Erreichung eines Kosteneinsparungspotenzials durch Verkürzung der Prozesskette und Erhöhung der Salz- und Aluminiumausbeute des Gesamtprozesses. Aus wissenschaftlich-technischer Sicht stellt das Projekt die Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens unter Zuhilfenahme von veröffentlichten Laborergebnissen zu verschiedenen Einzelprozessschritten dar. Mit dem angestrebten Forschungsprojekt wird die Entwicklung eines Verfahrens zum direkten bzw. integrierten Recycling von Salzschlacken in schmelzflüssigem Zustand und Rückführung des Metall- und Salzinhalte der Salzschlacke in flüssiger Form in den Kreislauf sowie deren Erprobung des Verfahrens im Technikumsmaßstab verfolgt.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
-
Das Ziel des Vorhabens ist es, ein Kristallisationsverfahren zur Reinigung eisenhaltiger viel-komponentiger Al-Gusslegierungen von Fe, Mn, Mg, Ti mittels intermetallischer Fällung aufzuzeigen. Dabei soll insbesondere die Wechselwirkung mit dem Legierungselement Silizium untersucht werden.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
-
In der Aluminiumproduktion sind Fe, Si und Mn häufige Kontaminationsquellen. Durch die aktive Bildung und anschließende Entfernung von intermet. Verbindungen ist es möglich, diese Verunreinigungen zu entfernen. Um diesen Prozess wirtschaftlich zu gestalten, sollte die intermet. Bildung durch Zugabe zusätzlicher Spurenelemente optimiert werden. In einem systematischen experimentellen Suchprogramm werden die wirtschaftlich optimalen Additive ermittelt. Die anschließende Entnahmephase erfordert eine sehr genaue Temperaturregelung und die Entwicklung einer fortschrittlichen Aluminiumfiltrationstechnologie wie dem Verdrängungswaschen. Diese Entwicklungen werden im Labormaßstab durchgeführt und dann weiter ausgebaut. Das Endergebnis des Projekts wird ein halbkontinuierliches Inline-Filtermodul für die Entfernung von Fe, Si und Mn zu Kosten von weniger als 200 USD/t sein. Die Technologie wird in einer typischen Aluminiumgießerei eingesetzt, zum Beispiel zwischen Schmelz- und Gießöfen.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Das Schmelzen von stark verunreinigten oder feinteiligen Schrotten erfolgt oft unter einem Salzbad, welches üblicherweise aus NaCl, KCl und Fluoridsalzzusätzen besteht. In Deutschland werden am häufigsten Schmelzsalze auf Basis eines Salz-gemisches aus ca. 70 % NaCl und ca. 30 % KCl eingesetzt. Als Fluoridsalze dienen meistens CaF2 und seltener Kryolith. Es gibt wenige Untersuchungen, die sich auf dieses Basissalzgemisch beziehen. Daher wurden in dieser Arbeit die Eigenschaf-ten des Schmelzsalzes und deren Einfluss auf die Schmelzausbeute beim Schmel-zen von Aluminiumschrott untersucht. In der Literatur sind die Grundeigenschaften des Schmelzsalzes, wie Dichte und Oberflächenspannung in Abhängigkeit von der Temperatur, der CaF2- und der Na3AlF6-Konzentration nicht verfügbar. Zur Ergänzung dieser Lücke wurden sie in dieser Arbeit gemessen.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Das Ziel des laufenden Projektes ist die Entwicklung einer Einschmelzmethode für feinteilige Al-Reststoffe, die sowohl eine hohe Ausbeute an Aluminium gewährleistet als auch den Salzschlackenanfall minimiert. Das neue Verfahren basiert auf einem kontinuierlichen Einschmelzen von feinteiligen Al-Vorstoffen unter großem Salzüberschuss (ideale Bedingungen) sowie auf der gleichzeitigen Abtrennung der Oxide aus der schmelzflüssigen Salzschlacke mittels einer Tauchzentrifuge. Statt einer flüssigen Salzschlacke fällt eine Filterrestmasse mit Oxidgehalten von bis zu 60 % an. Dies senkt den Salzbedarf und den Salzschlackenanfall. Ferner werden durch ein deutlich flüssigeres Salzbad (kaum Oxidgehalt) weniger Al-Tropfen in Schwebe gehalten, was die Metallverluste drastisch verringert. Da entstehende Filterreste bzw. konventionelle Salzschlacken im Zuge der Aufbereitung generell bei Bedingungen gelaugt werden, unter denen metallisches Al oxidiert, können damit durch die deutlich geringeren Al-Gehalte auch die gesamten Stoffstromverluste minimiert werden.
Titel
Projekt Art
Förderer
Laufzeit
Partner
Research Area
Description
Gesamtziel des Vorhabens ist die Entwicklung von Recyclingkonzepten für die Aufarbeitung und Verwertung von Schrotten aus Aluminium-Sonderwerkstoffen (Aluminiumschäume, Al-Fe-und Al-Mg-Verbundmaterialien sowie das Reinigen von Al-Schmelzen von Pb, Sn, Sb, Li und Cd. Diese sind wegen ihrer Gehalte an Legierungselementen oder Einbauteilen zur Zeit nicht in die bereits bestehenden Verwertungskonzepte des Aluminiumkreislaufs einzubringen, da sie sich negativ auf die Qualität der Sekundärlegierungen auswirken können. Die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden nach positivem Projektverlauf der Industrie, insbesondere den in Deutschland ansässigen Verwertern von Aluminiumschrotten (Schmelzwerke, Umschmelzwerke) zur Verfügung gestellt. Damit werden einerseits die Forderungen des Gesetzgebers hinsichtlich des Inhaltes des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erfüllt, wonach die Verwertung Vorrang vor der Beseitigung hat. Zum anderen kann die Wettbewerbssituation der deutschen Aluminium-Recyclingindustrie gegenüber ausländischer Konkurrenz verbessert werden.